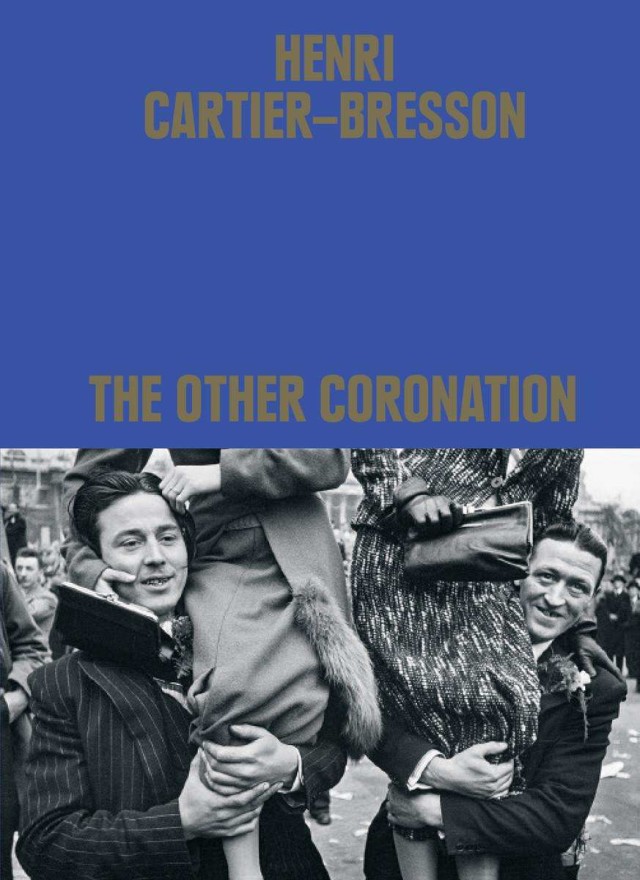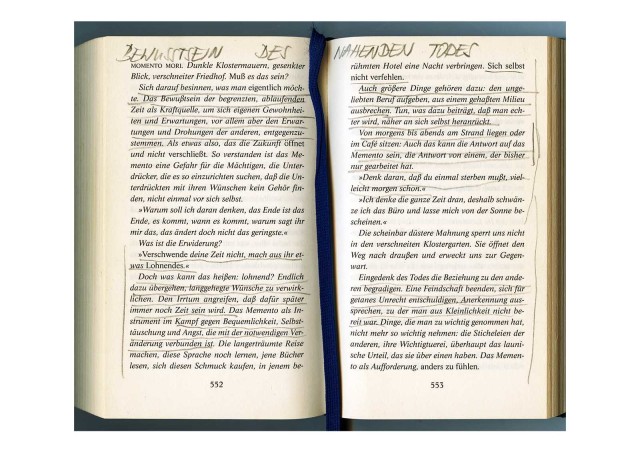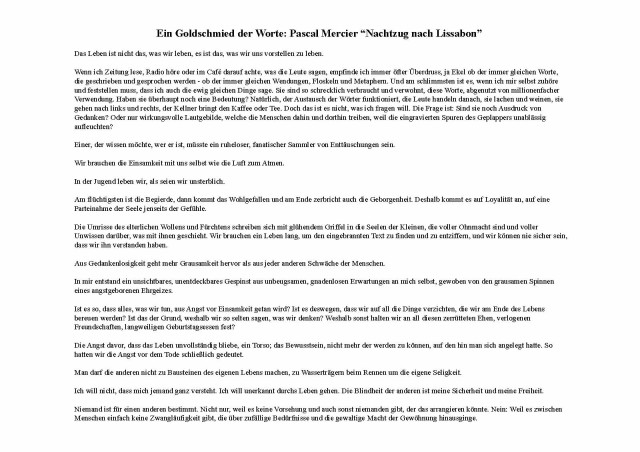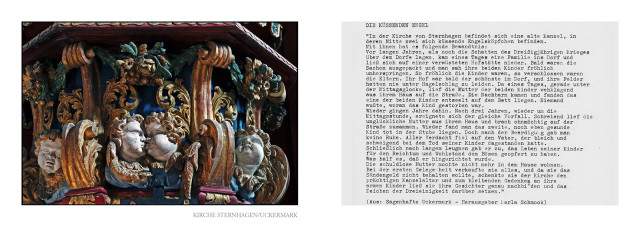Foto: Jabs
Eins der allerbesten Bücher, die ich gelesen habe. Benedict Wells schreibt überwältigend, ich musste oft weinen und konnte oft nicht aufhören zu lesen. Deshalb beschreibe ich nichts, kann diesen umwerfenden Roman aber nur wärmstens empfehlen.
Diese Geschichte hat mich gefesselt!
PS: Benedict Wells wurde als Benedict von Schirach geboren, legte seinen Geburtsnamen aber ab als er Schriftsteller werden wollte und nicht von seiner Verwandtschaft (Cousin) mit Ferdinand von Schirach (erfolgreicher Schriftsteller, Strafverteiger) profitieren wollte.
Zitate:
“Am wichtigsten ist es, dass du deinen wahren Freund findest. Dein wahrer Freund ist jemand, der immer da ist, der dein ganzes Leben an deiner Seite geht. Du musst ihn finden, das ist wichtiger als alles, auch als die Liebe. Denn die Liebe kann vergehen.”
und noch mal:
“Weißt du, was mir dein Vater vor seinem Tod gesagt hat? Er hat gesagt, es sei wichtig, einen wahren Freund zu haben, einen Seelenverwandten. Jemand, den man nie verlieren würde, der immer für einen da sei. Das wäre viel wichtiger als Liebe.”
“Das Gegengift zu Einsamkeit ist nicht das wahllose Zusammensein mit irgendwelchen Leuten. Das Gegengift zu Einsamkeit ist Geborgenheit.”
“Du allein trägst die Verantwortung für dich und dein Leben. Und wenn du nur tust, was du immer getan hast, wirst du auch nur bekommen, was du immer bekommen hast.”
“Ich war davon überzeugt, dass man sich zwingen konnte, kreativ zu sein, dass man an seiner Phantasie arbeiten konnte, aber nicht an seinem Willen. Das wahre Talent war der Wille.”