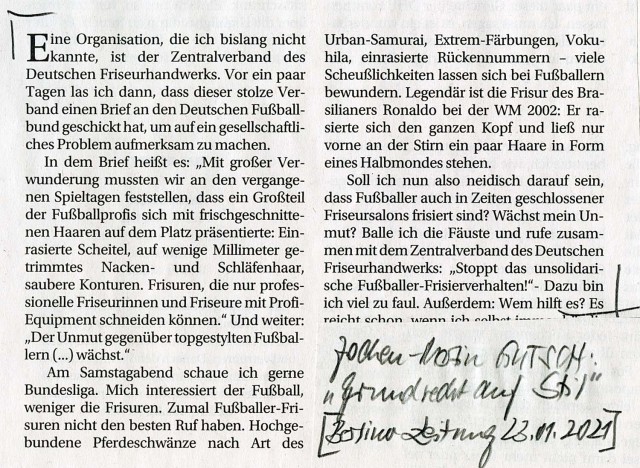Monthly Archives: January 2021
Uckermark: Gerswalde
Fussball: Fernsehfußballkommentar
Bücher, Mattscheibe: Alexander Osang: “Fast hell”
Mattscheibe, Musik: The Rolling Stones
Bücher, Musik: “True Faith”
Axel Mewes – Wahrer Glaube
New Order „True Faith“
(in: Ich liebe Musik Vol. 2, Hrsg. Jörg Hiecke & René Seim)
Eine Freundin hat mir mal von ihrer Beobachtung erzählt, dass Männer – anders als Frauen – diese eine große Liebe hätten. Die sie bis zum Ende ihrer Tage im Herzen tragen, ganz gleich, was in ihrem Leben passiert.
Sie hat recht. Wobei es bei mir und der Musik ein bisschen komplizierter ist.
Das erste Kribbeln in den Trommelfellen spürte ich im Alter von 10 Jahren. Meine große Schwester besaß einen Kassettenrekorder; irgendwann öffnete sich ihre Zimmertür, hinter der „Equinoxe” von Jean-Michel Jarre lief. Ein andermal nuschelte Udo Lindenberg durchs Sternholzimitat, „Live Rust” von Neil Young war gerade erschienen, Mark Knopfler zupfte die „Sultans of Swing”.
Anfänge des musikalischen Jugendlebens, während samstags nach der Schule Mutter die Fenster zu Lord Knuds „Evergreens à Go Go” vom RIAS Berlin putzte. Was auch irgendwie fetzte, weil die Frau, der ich für den Rest meines Lebens den Satz „Fürs Tanzen hätte ich das Vaterland verraten!” zuschreiben werde, die Gassenhauer lauthals fröhlich mitsang und in meiner Erinnerung samstags IMMER die Sonne schien. Wochenend’ und Sonnenschein. Und Musik.
Bis zur großen Liebe sollte es noch ein paar Jahre dauern, denn auch in musikalischer Hinsicht war ich ein Spätentwickler. Durch die Pubertät halfen mir – seit der Jugendweihe unterstützt durch einen eigenen Babett-Rekorder – Nenas erste beiden Platten und ab 1983 Depeche Mode. Ansonsten nahm der Kleinstadtjunge popkulturell alles mit, was die Achtziger zu bieten hatten – mit voller Verachtung für die Machenschaften von Dieter Bohlen und Michael Cretu selbstverständlich!
New Wave statt Rock und Blues, Trevor Horn statt Stock Aitken Waterman.
Ich war ein artiger Junge, meine Freizeit bestand an fünf Nachmittagen die Woche aus Training, am sechsten aus Bolzen mit Freunden und dem Spiel am Sonntag. Personen bzw. Umstände, gegen die es sich vor 1989 zu revoltieren lohnte, gab es jenseits nervender Lehrer und konditionsbesessener Fußballtrainer für mich wenig. Das bisschen Zeit, das übrig blieb, gehörte der Musik.
Dabei wurde allerdings immer klarer, dass diese nur deshalb auf dem zweiten Platz meiner Freizeitaktivitäten gelandet war, weil der Sport keine Nebenbuhlerin duldete. Es gibt nicht viel, was ich im Rückblick auf meine Jugend anders machen würde, wenn ich es könnte. Dass ich zweimal die Woche Training gegen das Erlernen eines Musikinstruments tauschen würde, gehört dazu.
Da Schule und Sport zwei völlig unterschiedliche Welten ohne personelle Überschneidungen waren, hatte ich zwar reichlich Klassen- und Mannschaftskameraden, mit denen ich auch gut zurechtkam, aber keine wirklichen Freunde. Ich verbrachte einfach zu wenig freie Zeit mit ihnen. Dasselbe galt für meine Familie, die ich eigentlich nur zu den Mahlzeiten an den Rändern des Tages und die eine Stunde bis zum Schlafengehen sah.
Ich vermute, dass die Musik deshalb früh den Platz des besten Freundes und später den der ersten Freundin einnahm. Sie war da, wenn ich sie brauchte. Sie kümmerte sich um mich, sie gab mir Kraft, Anerkennung und Trost, und sie erzählte mir die Geschichten, die mir sonst niemand erzählte.
Sie war die Erste, für die ich etwas Besonderes empfand.
Depeche Mode raubten mir die musikalische Unschuld und ließen mich dann zehn Jahre nicht los, obwohl es nach dem ersten Rausch eine Menge neuer Beziehungen gab. Heute schaue ich mit wohlwollender Gleichgültigkeit auf die hyperventilierenden DeMo-Aficionados, die der Band auch im fortgeschrittenen Alter noch auf Ihren Europa-Gigs hinterherfahren.
Ich höre in neue Alben gern mal rein, aber wenn ich mal ein paar Minuten für Musik habe, bleibe ich beim Scrollen durch meine Phonothek selten bei ihnen hängen.
Zum Spätentwickler passte, dass ich bereits 16 war, als ich zum ersten Mal eine öffentliche Disko betrat. Es war die Zeit der sehr bunt bemalten Mädchen mit sehr hochtoupierten Haaren und der Jungs in Schiedsrichterhemden mit schwarzen Lederkrawatten. Berlin war nicht weit weg, im Club liefen „Our Darkness”, „Fade To Grey” und „Tainted Love”.
Und: „Blue Monday”.
Der Song bedeutete mir nichts. Neil Tennant von den Pet Shop Boys hat mal von seinem Erweckungsmoment beim Hören des Stückes gesprochen und wie sehr dieser elektronische „Umpta-Umpta, Umpta-Umpta, Umpta-Umpta” Rhythmus das gewesen sei, was sein Mitstreiter Chris Lowe und er immer hatten machen wollen. Mich ließ der harte, leere elektronische Sound sprichwörtlich kühl. Kein Gefühl. Das unnahbare schöne Mädchen an der Bar, von der du spürst, dass sie eine Nummer zu groß für dich ist.
Die coolen Jungs in meinem Freundeskreis wussten damals schon, dass New Order, die hinter „Blue Monday” steckten, aus der Asche einer musikalisch deutlich anderen Band entstanden waren. Das machte mich neugierig auf Joy Division, zu denen ich allerdings erst Zugang fand, als die Zeit für den Austausch tief enttäuschter Blicke auf dem Betriebsberufsschulhof gekommen war.
Da Traurigsein und Singen für einen grundsätzlich optimistischen Heranwachsenden auf Dauer doch zu anstrengend sind, war es irgendwann dann auch mal gut mit der Depression. Es dauerte zwar noch Jahre, bis sich auf meinen Mixed Tapes fröhliche Songs fanden, aber vielleicht habe ich den verletzungsfreien Abschied von „Unknown Pleasures”, „Floodland” und „Disintegration” nicht zuletzt New Order zu verdanken, die sich nach dem traurigen Ende von Joy Division mit den Jahren häuteten und sich in meinen konfusen, aber letztlich doch lebensbejahenden Zeiten als junger Erwachsener in mein musikalisches Herz spielten.
Das Verliebtsein war in vollem Gange, wechselnde Beziehungen im Albumveröffentlichungstakt: Vorfreude, Jubel, Enttäuschung und die nächste bitte. Von der einen großen Liebe keine Spur – und doch kamen sie beide am Ende dann noch zusammen.
Als die mit den grünen Augen mich verließ, gab sie mir zum Abschied die Compilation „Heart and Soul” in die Hand, die sie sich gekauft hatte, weil wir an zwei verschiedenen Orten lebten. „Es sei die Deine”, sagte sie und brach mir das Herz.
Es gibt natürlich kaum bessere Musik, um sich in seinem Unglück zu suhlen als Joy Division, aber als ich den Kopf so langsam aus der Schlinge bekam, wurde es allmählich hell. Ich behaupte mal, dass dies 1994 der Auslöser dafür war, dass ich etwas zurückspulte und mich an New Order erinnerte. Ich hatte die frühen Platten gehört aber Schwierigkeiten mit der Metamorphose von Joy Divisions Düsterkeit zur Disko-Mucke ihrer Nachfolgeband. Als 1987 „Substance” erschien, stand mir der Sinn einfach noch nicht nach Tanzen. Die richtige Band zur falschen Zeit. Allerdings waren mir der Elektroniksound, Peter Hooks Bass und der eher dünne und vielleicht gerade deshalb unverwechselbare Gesang von Bernard Sumner in Erinnerung geblieben. Und ich wurde langsam erwachsen – Disko ging und selbst Lachen auf der Tanzfläche war erlaubt.
Mit siebenjähriger Verspätung hörte ich mir „Substance” schön und irgendwann blieb ich immer wieder beim letzten Song der ersten CD hängen. Wie bei einer Menge anderer Bands, deren größte Erfolge selten auch meine Lieblingssongs sind, ging und geht es mir mit New Order. „Blue Monday” finde ich mittlerweile OK aber sollte ich noch einmal in die Lage geraten, mir bei einem DJ einen Song zu wünschen, dann wird dies derselbe sein wie jener, auf den ich mich schon Wochen vor den raren Konzerten der Band freue: „True Faith”.
Es ist mein Lied, es ist perfekt.
Es ist Pop und Indie.
Es ist tanzbar, ohne Funk oder R&B zu sein.
Es ist ein Song, der die Dunkelheit Joy Divisions noch in sich trägt, aber auch die Aussicht auf bessere Zeiten.
Es ist das gelobte England fern hinter dem Eisernen Vorhang, es ist Manchester in den Achtzigern. Es hatte die besten, fettesten Synthesizer, als ich noch Synthesizern hinterhergestiegen bin.
Es hat die Hook Line. (Auch wenn der Peter leider Fan des völlig falschen Fußballvereins ist!)
Es hat ein Video, das ein Kunstwerk seiner Zeit war.
Es hat eines der schönsten Plattencover aller Zeiten.
Es hat die beste aller New Order B-Seiten.
Es hat einen Text, der mit Drogen zu tun hat, aber nicht von ihnen handelt. Die erste Halbstrophe reicht mir, um mich an miesen Tagen von übler Laune zu befreien:
I feel so extraordinary
Something’s got a hold on me
I get this feeling I’m in motion
A sudden sense of liberty
Und wie oft habe ich in Momenten, in denen lang gehegte Hoffnungen in Erfüllung gingen oder große Anstrengungen belohnt wurden, unwillkürlich lächelnd
I used to think that the day would never come
I’d see delight in the shade of the morning sun
vor mich hingesummt.
Es macht mich sentimental, aber es hängt mir noch immer nicht zum Halse raus. Es erinnert mich. Es ist mit mir älter geworden und ich liebe seine Falten. Es ist meins.
Es ist Liebe. Die eine – für immer. True Faith.
Fussball: Glück im Spiel
Fussball: “Der Tag, an dem der Fußball starb.”
CAMPINO
„HOPE STREET“
Kapitel 12: „Heysel“
Im Mai 1985 hatte ich meinen letzten Arbeitstag in der Psychiatrie. Der Job hatte mir viel bedeutet, ich kam mit den Patienten und Pflegern gut aus und würde Herrn Nordmann vermissen. Dennoch konnte ich das Ende der Dienstzeit und die dadurch neu gewonnene Freiheit kaum erwarten.
Auch die Toten Hosen warteten schon ungeduldig. Uns blieb kaum Zeit zum Proben. Ein paar Tage später startete bereits die Tournee zu unserem zweiten Album Unter falscher Flagge. Wir spielten fast jeden Abend in irgendeiner kleinen Halle irgendwo in Deutschland, doch am Mittwoch, dem 29. Mai, hatten wir spielfrei. Ich überlegte deshalb, nach Brüssel zu reisen, um das Europapokalfinale der Landesmeister zu sehen: Liverpool FC gegen Juventus Turin.
Die Gelegenheit schien günstig, die Reds nach vielen Jahren wieder live erleben zu können. Das Spiel war ausverkauft, doch ich probierte noch über alle möglichen Kontakte, an eine Karte zu kommen. Meine Bemühungen blieben leider erfolglos, und weil ich am nächsten Tag eh wieder ein Konzert hatte, entschied ich mich schweren Herzens, es nicht auch noch in Brüssel auf dem Schwarzmarkt zu versuchen, sondern das Spiel vorm Fernseher zu verfolgen.
Ich wohnte mit unserem ehemaligen Gitarristen Walter November in einem Gartenhäuschen in Flingern. Flingern war zu der Zeit ein etwas rauer Arbeiterstadtteil und das Revier der Toten Hosen. Bis auf Kuddel lebten wir alle dort in einem Radius von zweihundert Metern um den Jet Grill herum. An jenem Abend hatte ich mir vorgenommen, das Spiel allein zu gucken. An Off-Tagen von Tourneen wollte ich ungern Leute sehen, um meine Stimme zu schonen. Ich hatte mir einen „Bauernteller Flinger Boy“ gemacht, eine Eigenkreation von Walter und mir. Sie bestand aus Reis, Erdnüssen und Ketchup und wurde auch von niemand anderem gegessen. Ich setzte mich damit in meinem Zimmer auf das Bett und schaltete gegen 19:30 Uhr den Fernseher an, ein altes dickes Gerät, das auf dem Teppichboden auf einer Spanplatte stand, darunter vier Ziegelsteine. Das war meine Idee von Gemütlichkeit.
Sie endete sofort, als ich auf den Bildschirm blickte. Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Der ZDF-Reporter Eberhard Figgemeier versuchte mit brüchiger Stimme zu beschreiben, was geschah: bürgerkriegsähnliche Zustände vor und im Brüsseler Heysel-Stadion. Die Kamera schwenkte über den sommerlichen Abendhimmel und die Fankurven. Aus der Entfernung sah alles nach einem dicht gedrängten, typisch euphorischen Publikum aus. 60 000 Zuschauer waren gekommen. Doch als die Kamera die Bilder näher heranzoomte, zeigte sich die Katastrophe. Hooligans aus Liverpool hatten einen altersschwachen Maschendrahtzaun niedergerissen und den benachbarten Block Z gestürmt, der voll mit Juve-Fans war. Einige hatten sich in den Innenraum gerettet, die meisten aber waren zu einer Mauer gerannt, die dem Ansturm nicht standgehalten hatte und kollabiert war. Menschen wurden eingequetscht oder zu Tode getrampelt, andere erstickten. Doch das hielt die verfeindeten Lager nicht davon ab, immer wieder mit Steinen und Stangen aufeinander loszugehen.
Tränen stiegen mir in die Augen. Ich sah ein paar (wie sich nachher herausstellte: insgesamt zwölf!) hilflose Polizisten umherirren. Niemand beachtete sie. Sanitäter versuchten, die Verletzten und Toten zu bergen, Absperrgitter wurden zu Bahren umfunktioniert.
Ich war vom Bett heruntergerutscht, stierte in den Fernseher. Tausend Gedanken in meinem Kopf. Waren das wirklich wir? Unsere Jungs aus Liverpool? Wer hatte wen provoziert, und wieso hörten die mit der Gewalt nicht auf?
Diese Fragen haben mich noch lange Zeit aufgewühlt, und erst viele Jahre später bekam ich darauf zumindest ein paar Antworten. Drei Menschen konnten mir schließlich schildern, wie sie die schreckliche Nacht erlebt hatten.
Mein Kumpel Graham, der als Zuschauer im Publikum war, LFC-Mitarbeiter George Sephton und Liverpools ehemaliger Spieler Craig Johnston, der an jenem Abend in der Startformation stand. Ihn hatte ich Anfang der Neunziger bei einem Fußballturnier des Musiksenders MTV kennengelernt. Wir verbrachten den ganzen Abend miteinander, und er erzählte mir ausführlich, wie es ihm damals ergangen war:
„Wir waren in der Kabine und zogen uns gerade um, da hörte ich einen lauten Aufschrei von draußen. Ich rannte sofort los, die Treppen hoch zum Spielerausgang, und beobachtete durch ein Gitter, wie keine sechzig Meter von uns verzweifelte Juve-Fans, gejagt von einer Horde Liverpoolern, zu dieser Mauer flüchteten und sich hochhangelten. Unser Torwart Bruce Grobbelaar war mir gefolgt, und dann sahen wir beide, wie die Mauer unter schrecklichem Getöse nachgab. Aus dem Chaos befreite sich ein blutverschmierter Mann in schwarz-weißem Juventus-Trikot, lief in unsere Richtung und schrie: „Tiere! Tiere!“ Dann tauchten Polizisten in Kampfanzügen am Spielerausgang auf und drängten uns zurück die Treppen runter.“
Viele Menschen im Stadion hatten von alldem nichts sehen können und überhaupt nicht begriffen, was passiert war. Es gab noch keine Handys oder andere Verbindungen nach draußen. So sangen die meisten Fans weiter ihre Lieder und wurden wütend, weil das Spiel nicht angepfiffen wurde. Durchsagen auf Englisch, Italienisch und Französisch wurden gemacht. Kaum jemand reagierte darauf.
Auch George Sephton, seit 1971 Stadionsprecher an der Anfield Road, war an diesem Abend in Heysel: „Ich war als Sprecher für die Liverpool-Fans angereist mit dem Auftrag, sie nach dem Spiel zu informieren, wann und wie das Stadion zu verlassen sei. Ich hielt mich in dem engen Ansagerraum mit den Mikrofonen auf. Wir waren zu dritt, der belgische Stadionsprecher von Heysel, der italienische Ansager für die Juve-Fans und ich. Wir waren alle drei frühzeitig eingetroffen, der Belgier hatte ein kleines Radio dabei, in dem leise Musik lief. Auf einmal riss die Musik ab, und es wurde eine Durchsage gemacht, auf Flämisch oder Französisch, ich konnte nicht verstehen, was gesagt wurde. Doch daraufhin rief der Belgier: „Oh my God!“ Er deutete runter in Richtung Block Z, wir konnten erkennen, dass dort alle in Aufruhr waren. „Eine Mauer ist eingestürzt!“ Die Stimme im Radio meldete sich wieder, er übersetzte geschockt: „Es heißt, fünf Tote seien geborgen worden!“ Und dann waren es innerhalb von zwanzig Minuten 39 Tote. Die UEFA wies uns an weiterzumachen, als sei alles normal.“
Viel zu spät traf die Verstärkung der Polizei ein, mit Pferden und Schlagstöcken gelang es kurzzeitig, die rivalisierenden Gruppen zu trennen. Nun durchbrachen auf der gegenüberliegenden Seite Hooligans des Juventus-Anhangs die Zäune und liefen angriffsbereit in den Innenraum und auf den Platz, sie wollten wohl ihre Kameraden rächen.
Ich starrte erschüttert in den Fernseher. Es war nicht so, dass Gewalt mir fremd war. Ich kannte das von der Ratinger Straße in der Düsseldorfer Altstadt, aber auch von unseren eigenen Konzerten, gerade zu jener Zeit Anfang der Achtzigerjahre, wo es zu vielen Schlägereien kam. Tränengasbomben wurden im Dunkeln gezündet, Menschen rannten in Panik zu den Ausgängen, und wahrscheinlich war es einfach nur Glück, dass dabei nie etwas Schlimmeres passiert ist. Oft wurden wir als Band in die Auseinandersetzungen mit reingezogen oder griffen ein, sprangen von der Bühne oder prügelten uns draußen auf der Straße. Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Jugendgangs gehören seit den legendären Straßenschlachten zwischen Mods und Rockern Anfang der Sechzigerjahre in England zur Jugendkultur. Punks gegen Teds. Punks gegen Skins. Fußballhools gegen alle.
Jeder junge Mensch, der das einmal erlebt hat, kennt den Adrenalinschub. Die Berauschtheit von der eigenen Stärke in einer Gruppe, der Moment, wenn die Ordnungskraft sich zurückzieht, der kurze Augenblick des Triumphs, der auch nur Teil einer Spirale ist, die nur eine Richtung kennt. Es ist immer das Spiel mit dem Feuer, bis man an den Punkt gerät, an dem die halbstarke Abenteuerlust umschlägt in eine Katastrophe, die nicht mehr aufzuhalten ist. Das ist der Augenblick, an dem sich alle wünschen, sie wären nie dabei gewesen.
Dieser Moment war im Heysel-Stadion schon seit Stunden überschritten. George erinnert sich: „Nach einer Weile kam ein Typ von der UEFA in unseren Raum und wandte sich an mich. Er sagte: „Wir haben entschieden, dass das Spiel stattfindet. Sie werden jetzt über die Stadionlautsprecher bekannt geben, dass die Partie sofort abgebrochen wird, sollten die Fans versuchen, den Platz zu stürmen.“ Ich sah ihn an und entgegnete: „Sind Sie verrückt? Wenn wir das durchsagen… angenommen ein Team schießt ein Tor, dann werden die gegnerischen Fans genau dies tun, um den Abbruch zu provozieren! Das habe ich in England schon einmal erlebt.“ Der UEFA-Mann bellte mich an: „Sie tun, was ich sage!“ – „Nein!“ Daraufhin drehte er sich um, holte einen Polizisten mit Pistole in den Raum und wiederholte: „Tun Sie, was Ihnen befohlen wird!“ Genau in dem Moment kamen die beiden Mannschaftskapitäne von Juve und Liverpool, Gaetano Scirea und Phil Neal, herein. Sie sollten über die Lautsprecher zu ihren jeweiligen Fans sprechen und sie beruhigen. Wir durften mit keinem Wort erwähnen, dass es Todesopfer gegeben hatte.“
Damals im Fernsehen stürmte ein Polizeiaufgebot noch den italienischen Fanblock, um die dortigen Randalierer einzukesseln, dann beendete das ZDF kurz vor Anpfiff die Übertragung.
Von den Geschehnissen am Boden zerstört, saß ich in meiner Wohnung zwei Autostunden von diesem Krieg entfernt. Brüssel war in diesem Moment ein anderer Planet. Wieso ließ man es zu, dass hier noch Fußball gespielt wurde?
Kein Liverpool-Spieler habe irgendwelche Toten gesehen, erzählte mir Craig Johnson. „Die meisten von uns sind unten in der Kabine geblieben und warteten ab. Es herrschte große Verwirrung, niemand hatte den Überblick. Nur gerüchteweise sickerte durch, dass Menschen gestorben waren. Wir machten uns Sorgen um unsere Freunde und Familien, die oben auf den Tribünen saßen. Die Mannschaften hatten untereinander kaum Kontakt. Es gab keine Absprachen, wie die Situation zu handhaben sei.“
Mein Freund Graham Agg, LFC-Fan seit seiner Kindheit, ist tief verwurzelt in der Liverpooler Fanszene. Er kennt sich aus mit den Konstellationen und Stimmungen zwischen den verschiedenen Gruppierungen und weiß oft schon vorher, ob eine Auswärtsreise freundlich oder ungemütlich wird. Und so kennt er auch die Vorgeschichte zu dem Abend in Brüssel. Der Ärger habe schon in Rom begonnen, sagt er, im Jahr zuvor, beim Europapokalfinale gegen den AS Rom. Das hatte Liverpool im Elfmeterschießen gewonnen. Als die Liverpooler feiernd das Stadion verließen, wurden sie von den Römern brutal angegriffen. Über dreißig Engländer kamen mit Messer- und Stichwunden ins Krankenhaus.
Wahrscheinlich, so Graham, hätten sich in Belgien einige Schläger für den damaligen Überfall revanchieren wollen.
Juve hat zwar nichts mit dem AS Rom zu tun, aber es war irgendwie eine England-Italien-Sache und wurde auf das Spiel gegen Turin übertragen.
„Den ganzen Tag über hatte sich die Atmosphäre in der Brüsseler Innenstadt aufgeheizt. In Bars und Restaurants und auf den großen Plätzen kam es immer wieder zu Übergriffen. Leuchtraketen wurden hin- und hergeschossen, die Stimmung wurde immer feindlicher. Aber dass es zu so einer Katastrophe kommen würde, hätte niemand ahnen können.
„Ich sehe Grahams Gesicht noch heute die Erschütterung an, wenn er davon spricht. Es war die schwärzeste Nacht des europäischen Fußballs, der Tiefpunkt der an üblen Momenten nicht gerade kurzen Geschichte britischer Hooligans. Als bekennender Liverpool- und England-Anhänger schämte ich mich sehr, so wie alle Reds-Fans. Wir hatten Schuld auf uns geladen, und die wog schwer. Ausgerechnet Liverpool! Die Fans des LFC galten bis dahin in Europa als feierfreudig, aber friedlich. Jahr für Jahr waren sie auf dem Kontinent unterwegs gewesen, und es hatte nie großen Ärger gegeben. Der Schock, die Trauer und die Verbitterung saßen tief, vor allem in Italien und bei Juventus Turin.
Zwanzig Jahre danach war das immer noch deutlich zu spüren, als am 5. April 2005 die beiden Mannschaften im Viertelfinale der Champions League erstmals wieder gegeneinander antraten, diesmal an der Anfield Road. Ich stand an meinem Platz im Stadion, Main Stand, und sah, wie die Liverpool-Fans vor dem Spiel über eine ganze Stadionseite hinweg eine riesige Choreografie ausbreiteten. Mit großen Buchstaben stand da geschrieben: „WE ARE SORRY!“
Daraufhin drehten sich alle im Juve-Block gleichzeitig und geschlossen um und zeigten uns den Rücken.
Noch heute bin ich fassungslos, dass es zu der Tragödie in Brüssel kommen konnte.
Die Veranstalter haben sicherlich katastrophale Fehler gemacht, das Stadion war baufällig und hätte niemals für ein solches Spiel zugelassen werden dürfen.
Korrupte Mitarbeiter des belgischen Fußballverbands hatten Tickets für den gesamten Block Z, direkt neben den Engländern, zu Schwarzmarktpreisen an Italiener verkauft, die dort natürlich niemals hätten stehen dürfen. Ein lächerlicher Maschendrahtzaun war die einzige Trennung von einem Bereich, der eigentlich für neutrale Zuschauer aus Belgien bestimmt war – nun aber vor lauter Juve-Fans aus allen Nähten platzte.
Wie die Spieler es geschafft haben, zum Spiel noch anzutreten und es zu Ende zu bringen, ist mir ein Rätsel. Ob es sinnvoll war, die Partie überhaupt anzupfeifen, fällt mir schwer zu beurteilen. Vielleicht war es nötig, um Zeit zu gewinnen, bis man die Lage unter Kontrolle hatte.
Wenn ich bei der UEFA etwas zu sagen gehabt hätte, wäre mein Vorschlag gewesen: „Wir tun so, als wäre es ein normales Spiel, lassen ein Team absichtlich 1:0 gewinnen und bringen morgen, wenn die Sieger den Pokal zu Ehren der Toten ablehnen, eine gemeinsame Erklärung heraus.“ Dass so etwas nicht geschehen ist, werde ich nie verstehen. Die Art und Weise, wie sich die Juve-Spieler nach dem Schlusspfiff trotz der Toten so ausgelassen über den Pokalsieg freuen konnten, wirkte auf mich verstörend. Die UEFA hat sich schon damals als rückgratlose, korrupte Organisation gezeigt.
An diesem Abend in meinem Zimmer in Flingern beschloss ich, dass ich mit dieser Art Fußball nichts mehr zu tun haben wollte. Eine lange Zeit schaute ich mir kein Match mehr an, weder im Stadion noch im Fernsehen. Die Sache war für mich gelaufen.